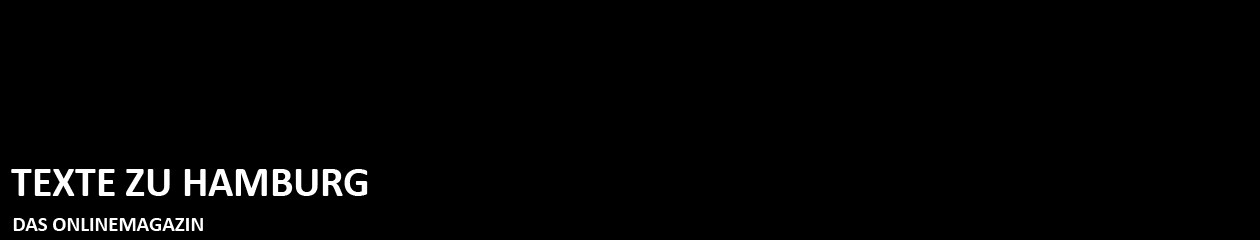Volker Ippig hat das alternative Image des FC St. Pauli geprägt. Er lebte in der Hafenstraße und leistete Aufbauhilfe in Nicaragua. Momentan nimmt sich der ehemalige Torwart die nächste Auszeit vom Fußball: Er arbeitet im Hafen. Von Matthias Greulich.
Heute war ein guter Tag für Volker Ippig. Seit dem frühen Morgen hat er Autos verladen am Schuppen 48 beim Unikai. Einsteigen. Aussteigen. Waggons hochklettern, die Wagen losmachen. „Du bist immer draußen unterwegs, musst anpacken. Bekommt mir gut“, sagt er nach der Schicht im Hamburger Hafen. Derartige Herausforderungen meistert der drahtige 51-Jährige immer noch wie ein Leistungssportler: „Die ersten Tage“, so Ippig, „war es wie im Trainingslager.“ Ein Arbeitsunfall hatte ihn im letzten Sommer vier Monate außer Gefecht gesetzt. Wie ein Profifußballer kämpfte er darum, wieder fit zu werden – „aber ohne die tolle Reha wie in der Bundesliga“.
Der Star, der im Hafen schuftet – eine Seltenheit in einem Geschäft, wo Profis als Berufswunsch angeben, nach der Karriere am liebsten „irgendetwas im Fußball“ machen wollen. Volker Ippig, Trainer des Schleswig-Holsteinischen Verbandsligisten TSV Lensahn und ausgebildeter Fußballlehrer des Jahrgangs 2005 geht den umgekehrten Weg: Seine mobile Torwartschule, mit der er in ganz Norddeutschland unterwegs war, hat bereits den Betrieb eingestellt, in Lensahn wird Ippig im Sommer aufhören.
Von 1981 bis 1991 stand Ippig – mit einigen Unterbrechungen – im Tor des FC St. Pauli. Der Keeper wurde am Millerntor zur Kultfigur. Der schwarze Block auf der Gegengeraden, Punks, Künstler und Studenten jubelten ihm zu, wenn er sie mit erhobener Arbeiterfaust begrüßte. Das T-Shirt „Volker, hör die Signale“ aus dem Fanladen verkaufte sich prächtig. Der Torwart stand gegen den Mainstream, hörte Punkmusik und sympathisierte offen mit der Hafenstraße. Wer links dachte, konnte sich fortan bei St. Pauli heimisch fühlen.
Ippig geht mit dem gerade auf allen Kanälen präsenten Mythos inzwischen sehr viel gelassener um, als unmittelbar nach seinem durch andauernde Rückenprobleme erzwungenen Karriere-Ende. Über das Etikett „St. Pauli-Legende“, das ihm angeheftet wird, kann er heute milde lächeln. „Die leben in der Vergangenheit. Ich lebe in der Gegenwart.“ Worauf er immer wieder angesprochen wird? Der Auftritt im „Aktuellen Sportstudio“, der ihn zur bundesweiten Identifikationsfigur machte: Der gelackte Moderator Bernd Heller hatte einem Millionenpublikum eröffnet, dass der Profi einige Monate bei den Autonomen in der Hafenstraße gelebt habe. „Für mich passt das nicht zusammen“, so Heller. „Für mich schon“, sagte Ippig trocken.
Auf einen derartigen Hype hatte anfangs wenig hingedeutet: Als der Schüler mit dem blonden Kurzhaarschnitt aus dem 5.000-Seelen-Dorf Lensahn zum FC wechselte, war der mythenbeladene Kiezklub noch ein ganz normaler Verein. Die Mitspieler in der A-Jugend trugen Poppertollen, teure Collegeschuhe und Bundfaltenhosen. Den Kosmos des Neu-Hamburgers bildete das Haus des damaligen Präsidenten Otto Paulick, dessen Familie ihn aufgenommen hatte, das Wirtschaftsgymnasium St. Pauli und das benachbarte Millerntor, wo auch die Übungseinheiten stattfanden. Vom Training fuhr er mit dem Rad oder schwarz mit dem 36er-Schnellbus zu Paulicks in die Elbchausse. „Ab und zu bin ich erwischt worden. Lässt sich nicht ändern.“
Ippigs großer sportlicher Ehrgeiz kollidierte schon bald mit einem zunehmenden Bedürfnis nach persönlichen Freiräumen. Dem befreundeten Albert Schindehütte sah er fasziniert zu, wenn der Künstler beim Frühstück mit dem Zeichnen begann. In den Plattenladen von Michael Ruff kam er regelmäßig, um das Neueste aus der Independent-Szene kennen zu lernen. Irgendwann brach er dann länger aus: Zwölf Monate war er Praktikant in einem Behindertenkindergarten, später ein halbes Jahr als Aufbauhelfer im sandinistischen Nicaragua. Im Hafen hat sich der Individualist nun die nächste Auszeit genommen, die er immer wieder zu brauchen scheint, „wenn es mit dem Fußball zuviel wird“. Eine Rückkehr in den Trainerberuf, den er zehn Jahre ausgeübt hat, schließt er nicht aus.
In der Aufstiegssaison 2001 machte er die Torleute des FC St. Pauli mit ungewöhnlichen Übungen fit, wozu bei ihm ausdrücklich auch geistige Beweglichkeit zählte. Dieser ganzheitliche Ansatz überforderte den Horizont des damaligen Cheftrainers Dietmar Demuth, der seinen ehemaligen Mitspieler loswerden wollte. „Es ist zuviel Scheiße passiert“, bilanziert Ippig. Anders als damals hebt er bei der Beurteilung der wirren Personalpolitik nach dem Bundesligaaufstieg nicht mehr die Stimme, als ob er seine Abwehrspieler im Strafraum dirigieren müsste. Irgendwann, da ist er konsequent, hörte er auf, in der „Traditionself“ des FC St. Pauli zu spielen. „Macht es doch alleine“, sagte er den Sportskameraden, als er erfahren hatte, dass einigen, die außerhalb Hamburgs wohnten, Fahrgeld gezahlt wurde, während er die Kosten stets selber getragen hatte.
Derart desillusionierende Erfahrungen haben den ehemaligen Angestellten zum distanzierten Beobachter der aktuellen Entwicklung gemacht. Schon lange war er nicht mehr im Stadion zu Gast, aller Sympathie zum Trotz. Beim Jubiläumsspiel der „St. Pauli Allstars“ gegen den FC United of Manchester kehrte er 2010 wieder auf den Rasen des Millerntor-Stadions zurück. Volker Ippig war einer der fittesten auf dem Platz.
Der Text ist in der SZENE Hamburg im Mai 2010 erschienen.
Lesen Sie auch die Themenwoche zum 100-jährigen Jubiläum des FC St. Pauli auf www.rund-magazin.de

„Wir waren Außenseiter“:Volker Ippig steht in der Nähe des Millerntor-Stadions Foto Matthias Greulich